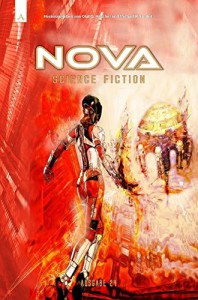Autor: Tobias Reckermann
Veröffentlichung in Zurück zu den Wurzeln
Veröffentlichung in Magische Realitäten
Veröffentlichung in Nova #24
Der schwarze Korridor
Es gibt einen Ort in meinen Träumen, der nur durch den schwärzesten Korridor zu erreichen ist. Obwohl mich auf diesem Gang jedes Mal Furcht überkommt, die Furcht, etwas könne aus der Finsternis nach mir greifen oder unermessliche Tiefe zu Seiten meiner Schritte könne mich erfassen und hinabziehen, gebe ich dem Sog des Orts doch immer nach, betrete den Korridor – nichts ergreift mich oder zieht an mir – und gelange dorthin, wo ein hohes Fenster das kalte Licht von Nebel hereinlässt. Nur Dunst ist dort draußen und schwache Schemen, nichts Festes, keine echte Form.
Tatsächlich ist das, was durch das Fenster zu sehen ist, nicht weniger furchterregend als der schwarze Korridor und doch zieht es mich dorthin. Und furchterregender als beides, Fenster und Korridor zusammen, ist, dass ich immer nach einem Ausblick in den Nebel an einer Stelle meiner Wohnung aus meinem Somnambulismus erwache, an der kein Fenster, kein Ausblick, auch kein dunkler Korridor liegt. Ich stehe dort nur vor einer Wand und fühle, als ob sich vor mir doch eine Leere auftut, die ich nur nicht sehen kann, als ob ein einziger weiterer schlafwandelnder Schritt mich über eine Schwelle getragen haben würde, als ob es danach kein Zurück mehr hätte geben können, als ob ich durch mein Erwachen die Gelegenheit zu wahrer Erkenntnis dessen, was in dem Nebel liegt, vertan hätte. Und immer fühle ich mich an dieser Stelle vollkommen allein, fühle, als ob der schwarze Korridor doch bereits hinter mir läge und mich von der Welt des Tages und der Menschen für ewig trennen muss.
Auf dieser Seite, in der Welt der Nächte und Traumgestalten, liegt Narkosa, die Stadt der Schlafenden. Die Stadt im Nebel. Ich weiß, dass sie da ist. Im weiß es im Traum, auch wenn ich sie nicht sehen kann. Und auf der Seite meiner Welt sehne ich mich dorthin, obwohl sie keine Geborgenheit verspricht, sondern nur eine Wahrheit, die ich im Wachsein nicht finden kann. Eine schreckliche Wahrheit, und doch …
Zuerst die Wahrheit, dass dort jener Korridor ist, und wenn er sich auch nicht zeigt, und dahinter die Stelle vor dem Fenster und der nebelverhangene Ort dahinter. Sie sind dort und von dem Hier nur durch die Mauer des Schlafs getrennt. Diese Mauer lässt sich so leicht durchdringen. So leicht, dass ich wegen meines Schlafwandelns nicht mehr sagen kann, auf welcher Seite ich mich wirklich befinde. Ob diese Seite der Traum ist oder jene das Hier und das Jetzt und meine Sehnsucht mich nicht schon an ihr Ziel geführt hat und doch nicht erlischt, nur weil ich den letzten Schritt nicht vollbringen kann? Es bleibt nur ein Mittel, es herauszufinden: die Schlafdroge. Morphium.
Eine einzige Injektion und alles ist anders, denn nach meinem furchtbaren Gang durch den schwarzen Korridor gelange ich nicht nur vor das hohe Fenster mit dem Ausblick auf den Nebel, sondern durchdringe ich das unsichtbare Glas, die letzte Grenze, als wäre es nicht vorhanden, und habe das Grauland betreten. Ich bin dort, wo die blassen Schemen und der Nebel und mein letztes Ziel, alle verschmolzen in eins, mich umfangen.
Sie liegen dort, wie die Steine eines Totenfelds, und regen sich nicht. Nur dem Gehör folgend gehe ich weiter in die Welt des Graus und dort hinaus heulen Wölfe einen unsichtbaren Mond an. Doch kann es sein, dass ich den schwarzen Korridor in Wahrheit nicht verlassen kann, denn die Furcht ist dieselbe, so als müsste ich mit dem nächsten Schritt auf meinen eigenen Grabstein stoßen. Als müsste ich tot sein in jener Welt und in dieser gestrandet und in der Stadt, die im Nebel vor mir flieht und belebt ist nur von Schlafenden und still daliegenden Steinen. Wenn ich es bin, was mag dann mit meinem Körper geschehen sein, dort drüben, von wo ich herkomme? Ich finde ganz gewiss den Weg zurück nicht mehr, durch das Glas und dorthin, wo kein Korridor liegt und nur jene nackte Wand in meinem Zuhause. Was ich getan habe, lässt sich nicht umkehren. Ich kann nicht umkehren. Ich bin jetzt ein Teil dieser Stadt, die immer schon meine Stadt war. Ich lebe unter den Wölfen, den Steinen, dem Nebel. Ich bin ein Einwohner von Narkosa.
(C) Tobias Reckermann, 2016
Woyzeck vs. Datterich – Battle of Giants
Darmstadt im April. Der diesjährige Vormärz ist bereits beendet. Die Sonne scheint. Der Herrngarten füllt sich mit hellem Grün und die Biergartenlust macht sich breit. Der neueste Knorz auf der Rückseite vom Tagblatt, Fahrradfahrer, Kinderwagen auf Rennchassis, Eisschlecken, die Lilien sind auf dem Vormarsch: Das Leben freut sich und ich halte nach bekannten Gesichtern Ausschau. Tatsächlich kann man sich sicher sein, dass einem auf dem Riegerplatz oder unterm Lui oder wo auch sonst in der idyllischen Großkleinstadt immer Bekannte über den Weg laufen, selbst wenn man es nicht wollte.
So weit ich sagen kann, sind sich Woyzeck und der Datterich nie begegnet, was doch seltsam ist, wo ich in Darmstadt beiden andauernd über den Weg laufe. Der eine schreit und stöhnt, weil sein Leben den Darmbach hinab rinnt, und der andere hat hinter seiner Alkoholfahne einfach eine große Klappe.
Eigentlich ist Woyzeck ja der ältere der beiden, allerdings, durch seine späte Uraufführung 1913, auch wieder nicht. In Bühnenjahren schlägt ihn Datterich um Jahrzehnte. Dafür wird Woyzeck heute weit öfter aufgeführt. Nehme mer mol an, im Jahre 13 – in der Alexanderstraße steht noch immer eine Infanteriekaserne und schlummert sich auf den Ersten Weltkrieg ein – hört Datterich, schon 72 Jahre Bühnenerfahrung auf dem Buckel, von dem störrisch tragischen Woyzeck. Sein erster „trockener“ Kommentar dazu: „Wer lässt sisch dann aach uffe Erbsediät ei?“ (War das jetzt echtes Heiner oder nur meine allhessische Version davon?) Bestimmt hätte Datterich noch sehr viel mehr zu sagen. Ich stelle mir vor, dass er mit seinem Breitmaul über Woyzeck herwalzt wie eine Artilleriegranate.
Datterich, der Hans Suff in allen Gassen, dagegen ist Woyzeck eher so eine Art Held im Wasserglas. Die Rebellion ist schon sichtbar, bricht sich aber an der Klippe der Eifersucht. Und das war es auch schon mit dem großen Aufbegehren. Seine Freundin hat er erstochen, noch nicht mal den Tambourmajor, mit dem sie ihn betrogen hat. Was für ein Tratsch daraufhin in Darmstadts Kneipen und in Traase, hinnerm Wald.
Datterich als Vormärz zu bezeichnen wäre schon ein starkes Stück, dabei ist die Zeit dieselbe. Das fürstliche Darmstadt in seiner bürgerlichen Verschlafenheit (ist das heute anders?) wartet nur darauf von den Wilden durchgeschüttelt zu werden, aber Büchner geht dafür ins Exil, so wie alle anderen Großen. Er stirbt, bevor sein Woyzeckfragment zum ausgewachsenen Drama gedeihen kann, da hat Niebergall schon den längeren Atem.
Darmstadt, könnte man meinen, hat die Revolution abgeschmettert wie einen tätlichen Angriff hinterm Heinerzelt: mit einem Bierkrug. Natürlich überlebt Datterich, die Saufnase, den armen Woyzeck. Man könnte sagen: Die Bohème schlägt sich durch.
Ein stadtbekannter Datterologe schreibt, Datterich sei eigentlich ein Punk. Punks laufen nicht Amok, sie sitzen um den Lui herum und trinken Bier, wenn man sie lässt. Für Chaostage ist Darmstadt nicht die richtige Stadt. Amok laufen die anderen, die gerne angepasst wären, es aber nicht schaffen und deshalb explodieren müssen. Deshalb läuft man auch in Schulen oder an der Börse Amok und nicht im Biergarten.
(Oder doch? Vergessen wir nicht, dass Datterich am Ende des Stücks noch seinen Mittelfinger streckt und sich aus der schwankhaften Posse heraus in das Finale einer Tragödie bugsiert!)
Es gibt auch andere Tage, an denen man niemandem begegnet, den man kennt, auch bei schönem Wetter im Herrngarten. Datterich kommt vielleicht vom Eingang an der Martinskirche und Woyzeck, zur gleichen Zeit, aus Richtung Schloss. Sie könnten am Ententeich aufeinandertreffen, laufen stattdessen aber beide in Uhrzeigerrichtung darum herum – Woyzeck verzweifelnd, Datterich schwadronierend – immer mit der Miniinsel und den darauf stehenden Bäumen zwischen sich. Die Lokalposse erkennt die Revolution nicht und der Vormärz ignoriert den Darmstädter Schmäh. Es wäre gut möglich, dass unsere beiden Lokalsuperhelden, diese Janusköpfe, einander gar nicht wahrnehmen können, dass sie trotz aller Synchronizität in verschiedenen Sphären leben. Die Bretter, die ihre Welten bedeuten, sind letztlich doch aus ganz unterschiedlichem Holz. Wohl weil das eine sich vor Lachen biegt und das andere bricht.
(C) Tobias Reckermann, 2015
Die Hässlichen oder das wahre Reich des Bösen
Eine Horrorgeschichte aus Dunkeldeutschland
Als sei die Bevölkerung dieses Landstrichs gänzlich einem gemeinsamen Zorn aufgesessen, der sie veranlasste, sie wie ein Tier anzusehen …, so kam es Naima vor.
(C) Tobias Reckermann, 2016
Die Tiefe in ihnen
Die Schwerkraft hat sie verlassen, schwebend in einer schwarzen Tiefe. Ein traumartiges Gefühl, bei dem ihre Haut am ganzen Körper knistert wie von darunter kriechenden Gedanken, die nicht ihre eigenen sind.
Jeder für sich vollzieht den letzten Abschnitt des Weges nach, von dem Moment an, an dem sie auf der grasbestandenen Ebene jenes Dickicht ausmachen, das allein aus dem Meer rollender Hügel unter der brennenden Sonne aufragt und Schatten verspricht. Die Entscheidung, dorthin zu gehen, die müden Schritte abwechselnd hinter dem jeweils anderen her, bis zu dem letzten Anstieg, der sie an den Rand des Dickichts führt. So einsam liegt es da, so unübersehbar, dass hier Zuflucht zu suchen sich so blöde ausnimmt, wie sich auf dem freien Platz vor einem Gericht zu präsentieren. Doch nirgends sonst gibt es Deckung, nicht vor der Sonne und nicht vor Blicken, wenn sie nicht reglos im hohen Steppengras liegen wollen und nur darauf warten, dass man sie einholt.
Das Gestrüpp hängt schwer auf den paar Bäumen, ringt sie nieder mit seinen Dornen an dürren Ästen und durstenden Blättern und düster schweben Schatten darin. Die Gestalt ist geduckt, in sich gekrümmt, schwermütig, als habe alle Schwere der weiten Ebene sich hierhin vor dem ausgreifenden Grün zusammengerafft, wie ein Haufen von Kehricht, letzte Reste des uranfänglichen Chaos der Welt.
Die Schatten darin sind bei genauem Hinsehen mehr als sie von Weitem scheinen, nicht aus der Überlagerung von Zweigen und Laub aufgehäuft, sondern halb verborgene Fensterlöcher und die Tür eines niedrigen Gebäudes aus totem, von Hitze bleichem Holz. Eine Hütte liegt unter dem Dickicht, wie niedergedrückt. Die Öffnungen gähnen schwarz, so schwarz, dass das Dunkel hervorzuquellen scheint in das grelle Licht. Ein Blick darauf ist wie das Eintauchen in eine andere, zweite Ebene der Existenz, wie der Anblick dessen, was sich unter lange daliegenden Steinen verbirgt. Sie können nicht zurück und nicht weiter hinaus. Sie schauen einander in die Augen. Sie von der Sonne rot im Gesicht und schwach, er schweißdurchnässt. Er fasst sie bei der Hand, führt sie in den Schatten und dessen trockene Kühle. Ein Blick über die Schulter bestärkt seinen Entschluss. Besser, hier zu warten, bis es Nacht wird, als da draußen zu verdorren.
In der Schwerelosigkeit und von den kriechenden Gedanken unter der Haut überreizt fängt sie zuerst an, ihn verantwortlich zu machen. Er hat sie hineingeführt, es ist also seine Schuld. Obwohl sie keine Schwere fühlt, ist ihr doch so als falle sie, endlos, falle in die Weite hinein, die sich so kalt wie der Kosmos um sie legt, so unausweichlich wie das All. Schreien würde sie, schreit vielleicht, ohne sich dessen vergewissern zu können, und er ist nicht bei ihr.
Er verflucht sie. Sie ist der Grund für ihre Flucht, also ist es ihre Schuld, dass sie die Hütte betreten haben. Jetzt ist sie fort, ist nicht bei ihm, er ist allein in der Leere, ist angefüllt mit Gedanken, die wie Dornen unter seiner Haut sitzen.
Wie sie die Hütte unter dem Dickicht durch die Türöffnung betreten und die Kühle ist so sehr im Kontrast zu der Hitze, dass sie zu zittern anfängt und er seine Arme um sie legt. Ihr soll bloß nichts geschehen. Ihm ja, wenn es sein muss, aber nicht ihr, die er liebt. Weil sie ihn liebt. Weil sie sich lieben und deshalb egal ist, was geschieht, solange ihr nichts geschieht.
Ihm nichts geschieht, denn ohne ihn wäre sie nicht nur schutzlos, sondern ganz allein in einer furchtbaren Welt. Ihm soll nichts zustoßen, aber er soll sie beschützen. Es ist gut, dass er seine Arme um sie legt, sonst wäre sie haltlos in dieser Schwärze. Sie halten einander aufrecht. Es ist so dunkel, dass sich der Raum grenzenlos anzufühlen beginnt. Das Dunkel ist so tief. So leer. Sie spürt seine Arme nicht mehr, verliert seine Nähe, seinen Schutz, und er verliert sie aus seinen Armen. Das Bewusstsein beider setzt aus. Es findet nichts, woran es sich halten kann, keinen Grund, keine Dimension, kein Gegenüber, keinen zweiter Herzschlag, kein Gesicht, keine Stimme, keinen Laut.
Es ist so finster, bis auf ein hell klingendes Zittern in dem was sie beide hält. Nur durch einen Hauch voneinander getrennt, so nahe beieinander, dass sie sich berühren könnten, wenn sie sich rühren könnten, ohne zu wissen, dass der andere so nahe ist. Etwas Beiniges, Armiges, stelzend Augendes, Bitteres, böse Wisperndes, Flüsterndes, kalt Atmendes, die Saiten ihres Netzes Schlagendes tastet sich über die Stricke ihrer Fesseln heran, befühlt sie beide mit feuchten, wimpernhaften Gliedern und kratzt mit Nadelfingern an ihren Gesichtern. Es öffnet ihre Augen.
Sie könnte nicht sagen, ob sie sieht oder spürt, dass sich rote Stiefel in ihr Sichtfeld bohren. Nur die Stiefel, stachelscharf, ohne eine Gestalt, ohne Form. Er sieht den Teufel in den blutroten Stiefeln, der die schwarzen Hörner bleckt und Hände kältester Nacht mit Klirren aneinander schlägt. Sie sind beide wach. Viel zu wach. Die Hütte aus Schatten hat sie beide verschluckt, in ihr tiefstes Inneres geschluckt, sie aufgehängt über dem Abgrund in einem Netz aus Nacht. Und doch kann er, kann sie fast jetzt aus den Fenstern schauen, wo dort draußen noch eine Welt ist unter den Schatten. Steht er bei ihr und sie bei ihm, dann stehen sie beide vor dem schwarzen Schlund im Maul des Alls. Was sie beide sind, ist der Kosmos mit aller Kälte und allem Gleichmut. Der Teufel in den roten Stiefeln herrscht. Sie lieben einander, schon, aber er wird nur einen wieder gehen lassen.
Er ist gebannt und denkt dornenscharfe Gedanken, sie zu stoßen, selbst zu fliehen, sie zu vergessen. Sie ist Schuld, muss also bleiben bei dem Teufel in dem Schlund. Sie denkt schneller und stößt ihn, dreht sich um, um selbst zu fliehen. Er ist Schuld, nicht sie, er muss bleiben bei dem Teufel in dem Schlund. Sein Schrei ruft Echos herauf aus der Tiefe, während er fällt. Der Teufel lacht kalt. Die Echos schlagen sie. Sie schreit und springt wie eine Heuschrecke zur leeren Öffnung der Tür. Die Welt liegt im Schatten. Das Lachen des Teufels folgt ihr.
(C) Tobias Reckermann, 2016
Straßenkunst
Ein Straßenkünstler,
an jener Ecke, wo solche gerne stehen,
trug einen flachen Hut
und dazu weites Hemd und Hose,
hampelte entsetzlich fuchtelnd
und griff sich in den aufgesperrten Mund,
zog etwas, das sich zunächst wehrte,
mit viel Kraft daraus hervor
und es war, mit sieben Beinen,
voll von schwarzem Haar und spitzen Dornen,
eher ein Insekt als eine Katze,
die selbst jetzt furchtbar zappelte,
er zeigte sie im Triumph umher
und verschlang sie dann am Stück
mit Haut und Haaren.
(C) Tobias Reckermann, 2016
Knochenwind
„Worauf verdammt sollen wir schießen?!“
„Auf alles was nicht so aussieht wie wir!“
Und sie ballern in die schnell und schneller vorbeiziehenden Bäume, in die Dickichte aus unförmigen, sich bewegenden Schatten.
Fetz gibt Gas, weil er Angst hat, aber fahren kann er. Das Hin und Her auf dem nassschwarzen Asphalt, wenn Fetz darauf liegendem Schrott und Körpern ausweicht, macht dass sich Sick und One an den Rahmen der Seitenfenster festhalten müssen, um nicht aus dem Fahrzeug zu kippen, während sie Schemen erschießen.
Der Wind krallt mit Knochenfingern nach ihren Gesichtern, reißt Haut von Fleisch. Es geht noch schneller durch die Zeit. Sie fliegt vorbei, bleibt als etwas Verdorbenes hinter ihnen liegen. Fangarme entrollen sich wie Feuerwehrschläuche, bis das Profil der Reifen sie auf die Straße nagelt.
Entweder heult der Wind oder der tanzende Aufruhr an den Seiten des Fahrwegs oder beides. Vielleicht ist beides dasselbe. Magazine klacken heraus, Sick und One laden nach, schießen weiter. Sick brüllt dabei, während One präzise und still die fahnenhaften Andeutungen von Gesichtern anvisiert, durchzieht, feuert, anvisiert. Der Außenbezirk empfängt sie mit Stacheldrahtzäunen, Sirenengeheul, dem Widerhall von Explosionen und Feuerschein. Autos stehen quer, brennen und verbreiten Rauch. Nur wenig langsamer steuert Fetz dazwischen hindurch, umschifft Untiefen und Felsgrate aus aufgerissenem Blech. Noch langsamer über die Kreuzung, auf der ein Lastzug umgestürzt ist, wie ein sterbender Wal am Strand liegt er mit klaffendem Bauch und verspritzt Flammen. Danach sieht die Straße frei aus, von dunklen Nebeln abgesehen, durch die hindurch Fetz wieder beschleunigt. Straße frei, Gas, mehr Gas, der Motor schreit. Die beiden in den Fenstern schießen blind in die Wolken.
Über die nächste Kreuzung. Eine schwarze Wand fällt herab, mitten in die Linie des Vierradprojektils. Crash. Dabei werden Sick und One in den Fensterrahmen entzwei gerissen und Fetz rast mit dem Kopf in den Luftsack, der unter seinem Gewicht seinen Atem ausstößt.
Das Gerippe eines kalten Morgens wölbt sich über der Zone. Als Fetz erwacht ist alles starr, das Blut getrocknet, der Blechschaden um ihn wie eine strenge Faust geschlossen, die schwarze Wand, in der die Fahrt geendet hat, verschwunden. Er schält sich aus dem Blech, stößt sich mit einem Tritt aus dem Truck und liegt in Ruß und klebrigem Zeug am Boden. Sein Blick richtet sich dorthin, wo sie hergekommen sind. Da liegt die Kreuzung. Sie sind durch die Wand gebrochen. In dieser Richtung liegt nichts, nur ein wabernder Teich glühender Schwärze und darüber eine pulsierende Wolke fahlen Beins. Der Sturm ist erstarrt und Fetz kann für eine Weile nicht anders als mit seinem Blick daran festhalten, auf eine Bewegung warten, einen Sprung zu dem das graue Monster ansetzen würde. Doch der bleibt aus. Fetz zwingt sich von dem Anblick fort, sieht auf dem Asphalt Körperteile verstreut liegen, die zu Sick und One gehörte, erstarrtes Blut, Risse im Straßenbelag und stadtwärts Trümmer und Rauch. Fetz kommt auf die Füße und setzt unter Schmerzen einen vor den anderen von dem geballten Sturm fort, immerzu in Furcht und das Gefühl der Unausweichlichkeit im Nacken, der Knochenwind könne sich hinter ihm auftürmen, ihn und die Stadt wie eine Springflut …
(c) Tobias Reckermann, 2016